Exkursion am 7. Juni 2002:
Wallburgen auf dem Lörmund & Hohler Stein
´Online-Version´
der ausgeteilten Kopien mit ergänzenden Bildern
(Die kleineren Bilder
können angeclickt werden,
damit sich ein neues Fenster mit einer Großansicht öffnet.)
![]()
Die Wallburgen auf dem Lörmund
Geschichte
der Wallburgenforschung in Westfalen
Die Geschichte der Wallburgenforschung ist eng verbunden mit der Geschichte
der 1897 gegründeten Altertumskommission für Westfalen, die in der
Erforschung der zahlreichen westfälischen Wallburgen eines ihrer Hauptziele
erblickte. Anfangs stand die Frage im Vordergrund, welche Rolle die Wallburgen
in den römisch-germanischen Auseinandersetzungen gespielt haben. (Eine
Fragestellung, die in zahlreichen Arbeiten von Hobbyhistorikern zur Varus-Schlacht
bis heute eine bedeutende Rolle spielt.)
1906 wurde innerhalb der Altertumskommission eine spezielle Atlaskommission
gegründet, die die Erarbeitung und Herausgabe eines Atlas der westfälischen
Wallburgen (nach niedersächsischem Vorbild) vorantreiben sollte. Die intensive
Arbeit zeigte erste Ergebnisse: als Hauptnutzungsperioden der Wallburgen in
Westfalen wurden die vorrömische Eisenzeit, die Zeit um Christi Geburt
sowie das Frühmittelalter (Auseinandersetzungen zwischen Franken und Sachsen)
erkannt.
1920 erschien der Atlas vor- und frühgeschichtlicher Befestigungen in Westfalen.
16 Burgen wurden vorgestellt, darunter auch die Wallburg auf dem Lörmund.
In der Folgezeit geriet dieses Projekt ins Stocken. Nach dem 2. Weltkrieg wurde
versucht, erneut an die Arbeit anzuschließen. Aber auch das mißlang
letztendlich. Ein Grund dafür liegt in der großen und noch immer
steigenden Zahl von zu bearbeitenden Anlagen. Die erste Aufstellung verzeichnete
ca. 150 Anlagen, 1962 waren es bereits über 600.
1972 beschäftigt sich Ph. R. Hömberg ausführlich in seiner Dissertation
Untersuchungen an frühgeschichtlichen Wallanlagen Westfalens mit einer
großen Anzahl von westfälischen Wallburgen.
Seit 1983 erscheint eine kleine Reihe Frühe Burgen in Westfalen, die gewissermaßen
das gescheiterte Atlas-Projekt in populärwissenschaftlicher Form und auf
Einzelhefte verteilt fortzusetzen sucht.
Die letzte ausführliche Beschäftigung mit Wallburgen liegt mit der
Ausstellung und dem Begleitbuch "Hinter Schloß und Riegel" aus
dem Jahr 1997 vor.
Forschungsgeschichte
Lörmund
Die Wallburg auf dem Lörmund erscheint schon 1888 in K. Mummentheis Erstes
Verzeichnis der Erd- und Steindenkmale des Süderlandes.
1906 Untersuchungen und Ausgrabungen in der Wallburg durch E. Hartmann. C. Schuchardt
und E. Hartmann deuteten die ergrabene Wallburg als das bei verschiedenen frühen
Geschichtsschreibern (Hrotsvit von Gandersheim, Widukind von Corvey, Continuator
des Regino von Prym) erwähnte Castellum/Praesidium Baduliki.
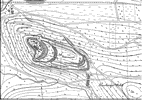 1920
erscheint ein neuer Plan mit knapp zweiseitigem Kommentar von F. Biermann und
J. H. Schmedding im Atlas vor- und frühgeschichtlicher Befestigungen in
Westfalen. Schon diese Autoren sprechen sich gegen die Gleichsetzung der Wallburg
auf dem Lörmund mit der Burg zu Belecke aus. Gleichzeitig werden historische
Informationen geboten.
1920
erscheint ein neuer Plan mit knapp zweiseitigem Kommentar von F. Biermann und
J. H. Schmedding im Atlas vor- und frühgeschichtlicher Befestigungen in
Westfalen. Schon diese Autoren sprechen sich gegen die Gleichsetzung der Wallburg
auf dem Lörmund mit der Burg zu Belecke aus. Gleichzeitig werden historische
Informationen geboten.
Die Beobachtung von Spitzgräben in der Altstadt von Belecke in den 30er
und 40er Jahren kann als Beleg für eine frühe Burg Belecke gelten,
die Gleichsetzung von Lörmund und Baduliki ist damit archäologisch
hinfällig.
Ph. R. Hömberg erwähnt in zwei Arbeiten der 70´er Jahre kurz
die Wallburg auf dem Lörmund. Zuletzt gibt es aus seiner Feder eine kurze
Zusammenfassung im 2001 erschienenen Führer zu archäologischen
Denkmälern.
Sein Vater - Albert K. Hömberg - hatte auf einen möglichen historischen
Hintergrund aufmerksam gemacht: In einer Aufzeichnung aus dem 12. Jahrhundert
beansprucht der Erzbischof von Köln folgenden Bereich als Ostervvalt -
Osterwald - für sich:
Ostervvalt tota silua pertinet ad beatum Petrum, icipiens a loco, qui dicitur Nezzelvvinkel per dotalem mansum in Odakker transiens in locum, qui dicitur Lininchusen et unde in flumen Rurem et inde in flumen, quod dicitur Almana.
Odacker ist eindeutig zu identifizieren, auch für Lininchusen gibt es Indizien (im Ruhrtal bei Enste), offen bleibt allein Nezzelwinkel, das in Verlängerung der Punkte Lininchusen - Odacker zu suchen ist. Die bei H. Schoppmeier und K. Süggeler vorgetragene, sich auf B. Kraft und J. S. Seibertz gründende Vermutung, der ´Netzewinkel´ habe einige hundert Meter westlich der Wallburg gelegen ist jedoch wenig wahrscheinlich. Mit dem Nezzelwinkel der Grenzbeschreibung ist keine jagdliche Einrichtung (Aufstellen von Netzen) gemeint sondern - bei Beachtung sprachlicher Kriterien - eine von Nesseln bestandene Fläche. Außerdem ist Nezzelwinkel östlich der Wallburg zu erwarten, zwischen Mühlheim und Belecke. Eine Möglichkeit der Lokalisierung könnte demnach im Möhnetal, direkt westlich des Schlosses Welschenbeck bestehen. Diese Flur trägt die Bezeichnung ´Alte Hof´, was einen sicheren Hinweis auf eine Wüstung, einen untergegangenen Hof darstellt.
Beschreibung
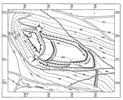 Auf
einem westlichen Ausläufer des Ochsenrückens, im Mündungswinkel
zwischen Möhne und Riemecke, befindet sich der aus mehreren einzelnen Wällen
gebildete Ringwall des Lörmunds.
Auf
einem westlichen Ausläufer des Ochsenrückens, im Mündungswinkel
zwischen Möhne und Riemecke, befindet sich der aus mehreren einzelnen Wällen
gebildete Ringwall des Lörmunds.
Zu unterscheiden ist eine kleinere hochmittelalterliche Anlage von einem deutlich
älteren Wallsystem. Die hochmittelalterliche Burg - der Standort der Kreuzbergkapelle
- ist durch einen tiefen sog. Halsgraben von der größeren Anlage
getrennt.
An der Westseite finden sich keine Wälle, hier reicht die natürliche
Geländesteile als Annäherungshindernis aus. Das aus dem Halsgraben
stammende Material wurde am Hang angeschüttet, noch heute sind die Schuttkegel
zu erkennen. Der 8 - 10 m tiefe Halsgraben trennt einen ca. 0,2 ha großen
Burgplatz vom restlichen Ringwall ab.
35 m östlich befindet sich ein weiterer Wall mit Graben. Die Wallenden
setzen an Terrassenkanten an. Dieser Wall kennzeichnet möglicherweise den
Kernbereich der alten Burg.
Das östliche Ende wird durch zwei weitere Wälle gebildet.
Unklar ist der alte Zugang zur Burg. Möglicherweise bestand ein Weg an
der Südseite, dann läge ein Tor mit "überlappenden Wallenden"
vor.
Die Kreuzbergskapelle wurde 1890 errichtet. Vorher - 1845 - wurde am Lörmund
ein hölzerner Kreuzweg errichtet, der 1865 durch Sandsteinkreuze ersetzt
wurde.
Neue
Fragestellungen
Bei den Ausgrabungen zu am Beginn des Jahrhunderts sind Reste vorgeschichtlicher
Keramik gefunden worden, denen man jedoch keinerlei Bedeutung beimaß.
Neue Erkenntnisse über die mehrperiodige Nutzung von Höhenbefestigungen
haben erst in den letzten Jahren zu einem anderen Verständnis dieser Anlagen
geführt. Es stellte sich heraus, daß gerade in der Jungsteinzeit,
im 4. bis 3. Jahrtausend v. Chr. Wallanlagen sowohl in der Ebene als auch auf
Sporn- und Gipfellagen der Berge errichtet worden sind.  Bekannte
Beispiele für Erdwerke in der Ebene sind Salzkotten-Oberntudorf und Soest
(mitten in der heutigen Innenstadt). Exemplarische Beispiele für Spornlagen
bei jungsteinzeitlichen Erdwerken sind die Oldenburg auf dem Fürstenberg
bei Neheim-Hüsten, sowie die Anlage bei Büren-Brenken. Für einige
dieser Anlagen wird heute neben einer vielleicht auch vorhandenen praktischen
Funktion vor allem die Funktion als kultisches Zentrum gesehen. Auf diese Weise
ließen sich ansonsten schwer erklärbare Befunde als Reste von Opferde-ponierungen
deuten. In der Michelsberger Kultur - ca. 4200 - 3500 v. Chr. - scheinen beispielsweise
die Spornbefestigungen tatsächlich zu Verteidigungszwecken erbaut worden
zu sein. Es gibt Hinweise auf längere Besiedlung, auf Zerstörung durch
Feuer, auch auf Kampfhandlungen. Die in der Ebene gelegenen Erdwerke dieser
Zeit weisen keinerlei Spuren von Besiedlung auf, sind strategisch ungünstig
gelegen. Hier scheint es sich um Versammlungsorte zu handeln.
Bekannte
Beispiele für Erdwerke in der Ebene sind Salzkotten-Oberntudorf und Soest
(mitten in der heutigen Innenstadt). Exemplarische Beispiele für Spornlagen
bei jungsteinzeitlichen Erdwerken sind die Oldenburg auf dem Fürstenberg
bei Neheim-Hüsten, sowie die Anlage bei Büren-Brenken. Für einige
dieser Anlagen wird heute neben einer vielleicht auch vorhandenen praktischen
Funktion vor allem die Funktion als kultisches Zentrum gesehen. Auf diese Weise
ließen sich ansonsten schwer erklärbare Befunde als Reste von Opferde-ponierungen
deuten. In der Michelsberger Kultur - ca. 4200 - 3500 v. Chr. - scheinen beispielsweise
die Spornbefestigungen tatsächlich zu Verteidigungszwecken erbaut worden
zu sein. Es gibt Hinweise auf längere Besiedlung, auf Zerstörung durch
Feuer, auch auf Kampfhandlungen. Die in der Ebene gelegenen Erdwerke dieser
Zeit weisen keinerlei Spuren von Besiedlung auf, sind strategisch ungünstig
gelegen. Hier scheint es sich um Versammlungsorte zu handeln.
Die Tatsache, daß auch die Wallburg auf dem Lörmund - leider nicht
näher bestimmte - jungsteinzeitliche Keramik erbracht hat, kann vielleicht
in diese Richtung weisen. Demnach wären zwar die heute zu beobachtenden
Wälle und Gräben früh- und hochmittelalterlich, dennoch spricht
einiges dafür, daß der Bergrücken schon einige Jahrtausende
früher regelmäßig von Menschen aufgesucht worden ist.
Ph. R. Hömberg geht eher von einer späteren Erstnutzung der Anlage
aus. Die Scherben und das möglicherweise vorhandene Tor mit überlappenden
Wallenden könnten auf eine erste Nutzung des Lörmundes in der vorrömischen
Eisenzeit hindeuten.
Aus diesem Grunde wäre eine Neuuntersuchung der Wallanlagen auf dem Lörmund
sehr wünschenswert - aber leider unbezahlbar...
Literaturliste
Zur Burg:
Zum historischen Hintergrund:
![]()
Der Hohle Stein bei Kallenhardt
 Geologische
Situation
Geologische
Situation
Vor 350 Millionen Jahren, im Erdzeitalter des mittleren Devon, bildeten sich
im Devon-Meer rund um Warstein mächtige Kalkstein-Schichten, ein Riff aus
den Resten abgestorbener Meerestiere. Am südlichen Rand des südlichen
der beiden großen Kalkstein-Züge des Warsteiner Sattels liegt der
Hohle Stein. In den folgenden Erdzeitaltern wurde die mächtige Kalksteinbank
durch Erdverschiebungen und gebirgsbildende Vorgänge gefaltet und geklüftet.
Kleinere dieser so entstandenen Spalten wurden im Laufe der Zeit wieder durch
kalkige Sedimente verfüllt.
Südlich des Hohlen Steins liegen die sog. Arnsberger Schichten, die vor
ca. 270 Millionen Jahren, im Erdzeitalter des Oberkarbon, entstanden.
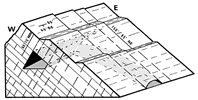
 Am
Fuße des Hohlen Steins trifft das kohlensäurehaltige Wasser der Lörmecke
auf den Massenkalk. Einerseits setzt der harte Kalkstein dem Wasser Widerstand
entgegen - die Lörmecke ändert in der Umgebung des Hohlen Steins die
Richtung - andererseits löst das saure Wasser den Kalkstein langsam auf,
und so konnten sich im Laufe der Zeit im Lörmecketal zahlreiche Höhlen
bilden. Am Beispiel des Hohlen Steins kann besonders gut der Zusammenhang von
Tektonik und Höhlenentstehung aufgezeigt werden. Die Form des Hohlraums
wird deutlich durch die Klüftung und Schichtung des Gesteins bestimmt.
Am
Fuße des Hohlen Steins trifft das kohlensäurehaltige Wasser der Lörmecke
auf den Massenkalk. Einerseits setzt der harte Kalkstein dem Wasser Widerstand
entgegen - die Lörmecke ändert in der Umgebung des Hohlen Steins die
Richtung - andererseits löst das saure Wasser den Kalkstein langsam auf,
und so konnten sich im Laufe der Zeit im Lörmecketal zahlreiche Höhlen
bilden. Am Beispiel des Hohlen Steins kann besonders gut der Zusammenhang von
Tektonik und Höhlenentstehung aufgezeigt werden. Die Form des Hohlraums
wird deutlich durch die Klüftung und Schichtung des Gesteins bestimmt.
 Beschreibung
Beschreibung
Die große Halle des Hohlen Steins hat eine maximale Längenausdehnung
von ca. 30 m, die maximale Breite beträgt ca. 20 m. Außerdem setzt
im Süden der Halle ein Nebengang an, der nach ca. 12 m zu Tage tritt.
Heute liegt der südliche Eingang etwa 3 m, das Höhlenportal im Westen
ca. 8 m über dem Normalwasserspiegel der Lörmecke. Die Höhle
bleibt also auch bei Hochwasser vollkommen trocken.
Forschungsgeschichte
 1928
- 1934 führten E. Henneböle (Rüthen) und J. Andree (Münster,
später ´SS-Hofarchäologe´) Ausgrabungen im Hohlen Stein
durch. Erst dadurch erreichte die Höhlenhalle ihre heutige imposante Größe.
Vor dem Entfernen der ca. 1500m3 Sediment war die Halle nur an wenigen Stellen
höher als etwa 3 m. In der Höhle fanden sich zwei klar unterschiedene
Kulturschichten. Die eine gehört in die ausgehende Altsteinzeit, fällt
mit dem Ende der letzten Eiszeit vor ca. 8.000 - 9.000 Jahren zusammen.
1928
- 1934 führten E. Henneböle (Rüthen) und J. Andree (Münster,
später ´SS-Hofarchäologe´) Ausgrabungen im Hohlen Stein
durch. Erst dadurch erreichte die Höhlenhalle ihre heutige imposante Größe.
Vor dem Entfernen der ca. 1500m3 Sediment war die Halle nur an wenigen Stellen
höher als etwa 3 m. In der Höhle fanden sich zwei klar unterschiedene
Kulturschichten. Die eine gehört in die ausgehende Altsteinzeit, fällt
mit dem Ende der letzten Eiszeit vor ca. 8.000 - 9.000 Jahren zusammen.
 Über
dieser Schicht fanden sich zahlreiche Relikte aus beiden Stufen der ´vorrömischen
Eisenzeit´ (ca. 750 v.Chr. - Zeitenwende): Keramikscherben, Fibeln, die
zum Schließen und Raffen der Kleidung dienten, Schmuck, Spinnwirtel, menschliche
Skelettreste.
Über
dieser Schicht fanden sich zahlreiche Relikte aus beiden Stufen der ´vorrömischen
Eisenzeit´ (ca. 750 v.Chr. - Zeitenwende): Keramikscherben, Fibeln, die
zum Schließen und Raffen der Kleidung dienten, Schmuck, Spinnwirtel, menschliche
Skelettreste.
 Interessant
ist in diesem Zusammenhang, daß ca. 1.000 m Bachaufwärts Eisenschmelzöfen
gefunden wurde. Scherbenfunde an diesem Fundplatz legen möglicherweise
eine gleichzeitige Nutzung der Öfen und der Höhle im Hohlen Stein
nahe. Derzeit wird die Gleichzeitigkeit der Funde jedoch teils skeptisch beurteilt.
Interessant
ist in diesem Zusammenhang, daß ca. 1.000 m Bachaufwärts Eisenschmelzöfen
gefunden wurde. Scherbenfunde an diesem Fundplatz legen möglicherweise
eine gleichzeitige Nutzung der Öfen und der Höhle im Hohlen Stein
nahe. Derzeit wird die Gleichzeitigkeit der Funde jedoch teils skeptisch beurteilt.
Seit der Entdeckung menschlicher Skelettreste im Hohlen Stein wird spekuliert,
ob es sich bei einem der Toten um ´König Attila´ von Soest
gehandelt haben könnte. Davon muß man jedoch Abschied nehmen. Der
Tote im Hohlen Stein ist schlicht einige Jahrhunderte zu früh gestorben,
um mit der Sage übereinzustimmen.
Wichtige Funde aus dem Hohlen Stein sind im Museum in Lippstadt ausgestellt.
Auch in der geschichtlichen Zeit - bis in die Neuzeit hinein - wurde der Hohle
Stein von Menschen bewohnt oder benutzt. 1590 flüchtete ein Schäfer
des nahegelegenen Schlosses Körtlinghausen mit seiner Herde vor Wölfen
in die Höhle. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts beherbergte die Höhle
gar eine Falschmünzerwerkstatt. 1813 diente der Hohle Stein einem zugezogenen
Sattler und Riemenschneider namens Föhring als Werkstatt und Notunterkunft,
bevor er die Erlaubnis erhielt, sich in der Stadt Kallenhardt niederzulassen.
Die Erinnerung an diesen Föhring dürfte wohl den Hintergrund einer
kleinen Höhlensage bilden:
"Zu Großmutters Zeiten war es bei der Höhle nicht recht geheuer. Die Seele eines Mannes namens Röing, der vor etlicher Zeit lebte und eines gewaltsamen Todes starb, wurde in den Hohlen Stein verbannt. Seitdem geht seine Seele dort um. Eines Abends wagte ein Übermütiger, sie aufzufordern: "Röing, kumm mol heri-ut!" Da fing es in der Höhle an zu rumoren. Unter donnerähnlichem Krachen kol-lerten schwere Brocken den Felsen herab, einer bis dicht vor Benz Mühle. Alle Leute in der Mühle machten vor Schreck das Kreuzzeichen. Der große und sonst so freche Wolfshund verkroch sich winselnd in eine Ecke. der Herausforderer wagte nicht, an dem Abend nach Hause zu gehen und bat, über Nacht in der Mühle bleiben zu dürfen." (nach Henneböle, 1963)
Im 19. Jahrhundert war der heute so auffällige große ´Haupteingang´ fast völlig verstürzt, kurz nach 1800 wird er noch als ´mäßig groß´ beschrieben, später scheint er ganz verschlossen gewesen zu sein. Die so entstandene Schutthalde wurde in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts abgebaut, um daraus Material zum Wegebau sowie Kalk zu gewinnen.
Zur
Interpretation der altsteinzeitlichen Funde
 Beim
Bau eines Klärbeckens bei Rüthen im Möhnetal, wurde unter ca.
2 m Auenlehm eine ca. 1 m mächtige Torfschicht gefunden. Bei der Untersuchung
der im Torf erhaltenen Pollen stellte sich heraus, daß die untere Schicht
des Torfes etwa aus der gleichen Zeit stammt, wie die steinzeitlichen Reste
aus dem Hohlen Stein, der jüngeren Dryas- und der Parktundrenzeit (also
ca. 9.000 - 8.000 v.Chr.). Die gefundenen Pollen geben Aufschluß über
Klima und Landschaft dieser Zeit. Es wurden nur vereinzelt Baumpollen nachgewiesen
(Weide, Birke, Kiefer), hauptsächlich Nichtbaumpollen. Bei Durchschnittstemperaturen,
die ca. 6ºC unter den heutigen lagen, hatte sich eine baumarme Tundra entwickelt.
Beim
Bau eines Klärbeckens bei Rüthen im Möhnetal, wurde unter ca.
2 m Auenlehm eine ca. 1 m mächtige Torfschicht gefunden. Bei der Untersuchung
der im Torf erhaltenen Pollen stellte sich heraus, daß die untere Schicht
des Torfes etwa aus der gleichen Zeit stammt, wie die steinzeitlichen Reste
aus dem Hohlen Stein, der jüngeren Dryas- und der Parktundrenzeit (also
ca. 9.000 - 8.000 v.Chr.). Die gefundenen Pollen geben Aufschluß über
Klima und Landschaft dieser Zeit. Es wurden nur vereinzelt Baumpollen nachgewiesen
(Weide, Birke, Kiefer), hauptsächlich Nichtbaumpollen. Bei Durchschnittstemperaturen,
die ca. 6ºC unter den heutigen lagen, hatte sich eine baumarme Tundra entwickelt.
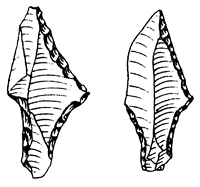 Die
verschiedenen Ausgrabungen rund um den Hohlen Stein in den ersten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts erbrachten eine große Anzahl von end-altsteinzeitlichen
Funden. Nach dem bedeutendsten Fundort wird diese Kultur die ´Ahrensburger
Gruppe´ genannt. Das typische Werkzeug ist die sog. Stielspitze.
Die
verschiedenen Ausgrabungen rund um den Hohlen Stein in den ersten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts erbrachten eine große Anzahl von end-altsteinzeitlichen
Funden. Nach dem bedeutendsten Fundort wird diese Kultur die ´Ahrensburger
Gruppe´ genannt. Das typische Werkzeug ist die sog. Stielspitze.
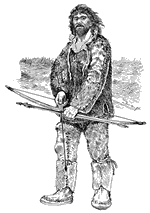 Neben
ca. 1500 Steinwerkzeugen, einzelnen Knochenwerkzeugen, fanden sich vor allem
Tierknochen, hauptsächlich vom Rentier, weiterhin Knochen vom Wollnashorn,
(Höhlen?)Bär, Eisfuchs, Schneehuhn und anderen Vertretern der eiszeitlichen
Tierwelt. Diese Knochen sind nun nicht gleichzeitig in die Höhle gelangt.
Sicher gleichzeitig mit den Werkzeugen der Ahrensburger Fundschicht sind allein
die Reste von Rentier, Schneehuhn, und Eisfuchs.
Neben
ca. 1500 Steinwerkzeugen, einzelnen Knochenwerkzeugen, fanden sich vor allem
Tierknochen, hauptsächlich vom Rentier, weiterhin Knochen vom Wollnashorn,
(Höhlen?)Bär, Eisfuchs, Schneehuhn und anderen Vertretern der eiszeitlichen
Tierwelt. Diese Knochen sind nun nicht gleichzeitig in die Höhle gelangt.
Sicher gleichzeitig mit den Werkzeugen der Ahrensburger Fundschicht sind allein
die Reste von Rentier, Schneehuhn, und Eisfuchs.
Die Funde des Hohlen Steins sind von außerordentlicher überregionaler
Bedeutung. Der Hohle Stein gehört zu den wichtigsten Funden der Ahrensburger
Gruppe im gesamten Mitteleuropäischen Mittelgebirgsraum (neben den Höhlenstationen
Kartstein und Remouchamps). M. Baales hat 1996 eine umfangreiche Dissertation
vorgelegt, in der er die "Umwelt und Jagdökonomie der Ahrensburger
Rentierjäger" beschreibt. Die Rentierjäger der End-Altsteinzeit
´folgten´ nicht den Herden - wie bis heute oft zu lesen ist - dafür
sind Rentierherden viel zu schnell. Statt dessen zogen sie den Herden voraus,
lauerten an Engstellen und Pässen. Diese sog. "head´em off at
the pass" Technik wurde bei rezenten Rentierjäger-Stämmen Nordamerikas
beobachtet, dann auf schon bekannte altsteinzeitliche Fundkomplexe übertragen.
Erst dadurch wurden bisher unerklärbare Befunde verstehbar, z. B. die häufig
gefundenen großen Mengen von winzigen Knochenbruchstücken. Die Knochen
wurden fein zerstoßen, mit Wasser aufgekocht, so daß sich das in
den Knochen enthaltene Fett löste und abgeschöpft werden konnte. Dieses
Knochenfett war der entscheidende Vorrat in Zeiten ohne Jagdmöglichkeit.
Ob solche Kleinstfragmente auch im Hohlen Stein gefunden wurden ist nicht mehr
zu klären, da sie möglicherweise nach der Ausgrabung verloren gegangen
sind.
Die Rentiere wanderten im Frühjahr aus den Wintereinständen im Tiefland
in die Sommereinstände in den Mittelgebirgen. An Engpässen wurden
sie auf diesen Wanderungen bereits von den Ahrensburger Rentierjägern erwartet.
Diese hatten offensichtlich die Zeit bis zum Eintreffen der Rentiere genutzt,
um Werkzeuge und Jagdwaffen in großer Zahl zu produzieren. Der besonders
geeignete Feuerstein ist aus mindestens 10 km Entfernung herbeigeschafft worden.
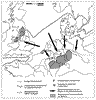 Im
Frühjahr wanderte eine Herde Rentiere von der Haar aus nach Süden,
überquerte die Möhne und nutzte das breite Glennetal, um tiefer in
den Arnsberger Wald eindringen zu können. Möglicherweise hatten die
Rentierjäger am Zusammenfluß von Glenne und Lörmecke das Glennetal
mit eine Barriere versperrt, um sicher zu gehen, daß die ganze Herde am
Hohlen Stein vorbeizog. An der Engstelle knapp unterhalb des Hohlen Steins konnten
dann mindestens 14 - wahrscheinlich aber erheblich mehr - Rentiere in kurzer
Zeit erlegt werden.
Im
Frühjahr wanderte eine Herde Rentiere von der Haar aus nach Süden,
überquerte die Möhne und nutzte das breite Glennetal, um tiefer in
den Arnsberger Wald eindringen zu können. Möglicherweise hatten die
Rentierjäger am Zusammenfluß von Glenne und Lörmecke das Glennetal
mit eine Barriere versperrt, um sicher zu gehen, daß die ganze Herde am
Hohlen Stein vorbeizog. An der Engstelle knapp unterhalb des Hohlen Steins konnten
dann mindestens 14 - wahrscheinlich aber erheblich mehr - Rentiere in kurzer
Zeit erlegt werden.  Die
Tiere wurden zerlegt, die Knochen zur Markgewinnung aufgeschlagen. Nachdem so
ein Vorrat an Nahrung und Werkzeugen geschaffen war, zogen die Jäger vielleicht
an andere Engpässe in der Nähe (Eppenloch, Bilsteinhöhle), oder
ebenfalls nach Süden, um in den Sommereinständen der Rentiere weiter
auf die Jagd nach einzelnen Rentieren gehen zu können. Als Last- und Zugtiere
dienten dieses Jägern ausschließlich Hunde. Ein Hund ist für
die Höhlenstation Kartstein mit einiger Sicherheit nachgewiesen, ein einzelner
Zahn aus dem Hohlen Stein könnte eventuell auch von einem Hund stammen.
Die
Tiere wurden zerlegt, die Knochen zur Markgewinnung aufgeschlagen. Nachdem so
ein Vorrat an Nahrung und Werkzeugen geschaffen war, zogen die Jäger vielleicht
an andere Engpässe in der Nähe (Eppenloch, Bilsteinhöhle), oder
ebenfalls nach Süden, um in den Sommereinständen der Rentiere weiter
auf die Jagd nach einzelnen Rentieren gehen zu können. Als Last- und Zugtiere
dienten dieses Jägern ausschließlich Hunde. Ein Hund ist für
die Höhlenstation Kartstein mit einiger Sicherheit nachgewiesen, ein einzelner
Zahn aus dem Hohlen Stein könnte eventuell auch von einem Hund stammen.
Im Hohlen Stein wurden zahlreiche dünne Geweihe von weiblichen oder noch
nicht ausgewachsenen Rentieren gefunden, die keinerlei Bearbeitungsspuren tragen.
Solche Funde kommen auch im Eppenloch und an anderen Fundstellen in Westfalen
und darüber hinaus vor. Es könnte sich hier eventuell um rituelle
Deponierungen handeln.
Der
Hohle Stein in der vorrömischen Eisenzeit
1982 überprüfte H. Polenz die Höhlenfunde des Sauerlandes auf
die Möglichkeit einer kultischen Interpretation: "Die aufgezeigten
Phänomene lassen keinen anderen Schluß zu, als daß wir es -
und dies gilt wahrscheinlich doch für alle - bei den hier besprochenen
Höhlen während der vorrömischen Eisenzeit mit Kultstätten
zu tun haben." Zu den besprochenen Höhlen gehörte auch der Hohle
Stein. W. Bleicher spricht sich in seiner Dissertation über Die Bedeutung
der eisenzeitlichen Höhlenfunde des Hönnetals eindeutig für eine
kultische Nutzung der Höhle aus. Wie bei ihm üblich, schließt
er aus neuzeitlichen Sagen schnell auf eisenzeitliche Praktiken.
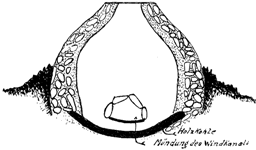 Mit
dem Ende der Bronzezeit, in der die Bewohner des Sauerlandes noch vollständig
auf importiertes Metall angewiesen waren, mit dem Aufkommen des neuen Werkstoffes
Eisen, kam es zu tiefgreifenden Veränderungen im Sauerland. Die bisher
dünn besiedelten Bergländer wurden durch ihre reichen Erzvorkommen
interessant. Möglicherweise stammen die im Lörmecketal ausgegrabenen
Schmelzöfen aus dieser Zeit, sicher ist das leider nicht. Verschiedene
Einzelfunde deuten auf Beziehungen zum südosteuropäischen Bereich,
zum Kernland der Hallstattkultur.
Mit
dem Ende der Bronzezeit, in der die Bewohner des Sauerlandes noch vollständig
auf importiertes Metall angewiesen waren, mit dem Aufkommen des neuen Werkstoffes
Eisen, kam es zu tiefgreifenden Veränderungen im Sauerland. Die bisher
dünn besiedelten Bergländer wurden durch ihre reichen Erzvorkommen
interessant. Möglicherweise stammen die im Lörmecketal ausgegrabenen
Schmelzöfen aus dieser Zeit, sicher ist das leider nicht. Verschiedene
Einzelfunde deuten auf Beziehungen zum südosteuropäischen Bereich,
zum Kernland der Hallstattkultur.
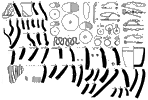 Im
Hohlen Stein fanden sich in der "Schicht IV" menschliche und tierische
Skelettreste, Schmuck und Trachtenbestandteile, Keramik, Spinnwirtel - also
das übliche Spektrum westfälischer Höhlenfunde der vorrömischen
Eisenzeit. Die noch immer verbreitete Deutung als Ort von Fruchtbarkeitsriten
mit Menschenopfern und Kannibalismus kann wohl zu den Akten gelegt werden, da
sich hier vielmehr Hinweise auf einen Ort der Sekundärbestattung mit ahnen-
und totenkultischen Riten ergeben. Ernst zu nehmen ist sicherlich der Hinweis
von W. Bleicher, der auf einen Schachtartigen Charakter der Höhle verweist.
Möglicherweise sind tatsächlich Skelettreste, Grabbeigaben und/oder
Opfergaben aus den höher gelegenen Teilen der Höhle in die tieferen
Teile geworfen worden. Die Schichtbeschreibung von Henneböle/Andree legt
diesen Eindruck nahe.
Im
Hohlen Stein fanden sich in der "Schicht IV" menschliche und tierische
Skelettreste, Schmuck und Trachtenbestandteile, Keramik, Spinnwirtel - also
das übliche Spektrum westfälischer Höhlenfunde der vorrömischen
Eisenzeit. Die noch immer verbreitete Deutung als Ort von Fruchtbarkeitsriten
mit Menschenopfern und Kannibalismus kann wohl zu den Akten gelegt werden, da
sich hier vielmehr Hinweise auf einen Ort der Sekundärbestattung mit ahnen-
und totenkultischen Riten ergeben. Ernst zu nehmen ist sicherlich der Hinweis
von W. Bleicher, der auf einen Schachtartigen Charakter der Höhle verweist.
Möglicherweise sind tatsächlich Skelettreste, Grabbeigaben und/oder
Opfergaben aus den höher gelegenen Teilen der Höhle in die tieferen
Teile geworfen worden. Die Schichtbeschreibung von Henneböle/Andree legt
diesen Eindruck nahe.
Literaturliste
Zur Geologie:
Grabungsberichte und ´alte Literatur´:
Bedeutung der end-altsteinzeitlichen Funde:
Bedeutung der eisenzeitlichen Funde: (Achtung: durchweg überholt!)
![]()
Linkliste zur Exkursion
|
Hier
klicken! |
Kurze
Beschreibung des Links
|
|
Links
zur Wallburg Lörmund
|
|
|
Vom Arbeitskreis Heimatpflege in Sichtigvor gibt es hier einige - grundsätzlich recht solide - Informationen über die mittelalterliche Geschichte der Wallburg auf dem Lörmund. |
|
| Gewissermaßen die Fortsetzung des vorherigen Links, Details über die Ausgrabungen und die mittelalterliche Burg auf dem Lörmund - ebenfalls vom Arbeitskreis Heimatpflege. | |
| Auf den Seiten des Kirchspiels Mülheim/Sichtigvor/Waldhausen gibt es diese Zusammenfassung der ´modernen Geschichte´ des Lörmunds, Informationen über den Kreuzweg und die Kapelle. | |
| Die Varus-Schlacht ist einfach nicht abzutöten, sie geistert nach wie vor in den Köpfen verschiedenster Heimat-Historiker herum. So auch hier: Ausgerechnet zu Füßen des Lörmunds soll sich Varus sogar in sein Schwert gestürzt haben...Die abstrusen Dinge über die Varusschlacht im Möhnetal | |
| Es muß offensichtlich sein: Eine gute Einstiegsseite - wichtige Links! - zu den Ausgrabungen in Kalkriese, dem einzigen Ort, der bisher archäologische Belege für die Varus-Schlacht vorweisen kann. | |
|
Links
zum Hohlen Stein
|
|
| Auf der offiziellen Seite der Stadt Rüthen gibt es auch ein paar kurze Hinweise zum Hohlen Stein - nicht so aufregend... | |
| Der Hohle Stein auf den Internet-Seiten der Gemeinde Kallenhardt - auch hier sehr wenig Hintergrund. | |
| Man darf gespannt sein, noch ist hier jedoch nichts zu sehen. | |
| Eine Seite aus dem Umfeld der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Brilon, leider ist dort noch nicht viel zu sehen (und gerade der interessante Photo-Bereich ist Passwort-geschützt...) | |
|
Links
zum Lörmecketal
|
|
| Nabu-Seite über das Lörmecketal | |
| Das Lörmecketal aus ökologischer Sicht, die Beschreibung des FFH-Gebietes. | |
|
Links
zum steinzeitlichen Umfeld
|
|
| Seite über die Höhlenstation Kartstein, die ebenfalls Belege für eine Gruppe Ahrensburger Rentierjäger geliefert hat. | |
| Die Ahrensburger Rentierjäger haben sogar Auswirkungen auf ein Stadtwappen - das von Ahrensburg natürlich - gehabt, im unteren Teil ist der sog. Kultpfahl von Stellmoor abgebildet | |
| Seite von Michael Baales, dem Verfasser der letzten umfangreichen Veröffentlichung über den Hohlen Stein und die Bedeutung der altsteinzeitlichen Funde. Mittlerweile ist er nicht mehr in Monrepos angestellt, er wird im Sommer Leiter der Außenstelle Olpe des Westfälischen Museums für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege - und damit ganz offiziell für den Hohlen Stein zuständig. | |
| Informationen über die Jungsteinzeit allgemein, über Erdwerke und Wallanlagen besonders, Aufsätze, Links... | |
Stefan Enste, Mai 2002
![]()
Homepage - Theologie - Geschichte - Urgeschichte - VHS-Kurse - Lokalpolitik - Links
![]()