7Q5
ist nicht Mk 6, 52 - 53
![]()
Zeitschrift
für Papyrologie und Epigraphik.
Band 126 (1999), S. 189 - 194
Qumran-Fragment 7Q5 ist nicht Markus 6, 52 - 53
Stefan Enste
1972 veröffentlichte der spanische Textforscher
J. O´Callaghan seine These, das Qumran-Papyrus-Fragment 7Q5 sei mit einem ntl.
Text, Mk 6, 52 – 53, zu identifizieren. (1) Nach einer kurzen Diskussionsphase
war es vor allem das Verdienst K. Alands, der These den Rang einer Außenseiterhypothese
zuzuweisen. (2) Abgesehen von J. O´Callaghan selbst (3) gab es nur noch in extrem
konservativen christlichen Kreisen Verfechter einer ntl. Identifizierung für
die Fragmente aus der Höhle 7Q. (4) So blieb es einige Jahre
ruhig, bis sich 1984 C. P. Thiede der Identifizierung annahm. (5) Neue Argumente für die ntl.
Identifizierung kann C. P. Thiede nicht vorweisen, er wiederholt, was 12 Jahre
vorher von J. O´Callaghan gesagt worden ist. Die papyrologische Kompetenz des
Autors wurde in ZPE 113 von H. Vocke beleuchtet. Die oberflächliche Arbeitsweise
in papyrologischen Fragen zeigt sich bereits in C. P. Thiedes erstem Aufsatz
zum Thema. Die dort gebotene Rekonstruktion des mit Mk 6, 52 – 53 identifizierten
Textes des Fragmentes 7Q5 ist so fehlerhaft – 7 Fehler in 5 Zeilen! –, daß im
folgenden Band ein Erratum veröffentlicht werden mußte. Doch selbst hier
bleiben Fehler stehen, so vermag C. P. Thiede zweimal nicht zwischen
einem Punkt nach dem Leidener Klammersystem und einem iota subscriptum
zu unterscheiden. Immer wieder ist es ihm gelungen, seine These publikumswirksam
zu inszenieren. Das hat schließlich Wirkung gezeigt, auch die Wissenschaft mußte
sich wieder mit der ntl. Identifizierung beschäftigen, die als längst abgehandelt
gelten könnte. (6)
Eigentlich genügt eine kurze und oberflächliche Betrachtung, um die ntl. Identifizierung
abzulehnen, zu groß sind die Abweichungen, zu groß ist die Zahl der notwendigen
Hilfshypothesen: Der sichere Buchstabenbestand von 7Q5 paßt nicht zum ntl. Text,
die Stichometrie geht nicht auf, die paläographische Datierung deutet eher auf
ein Datum vor der Zeitenwende hin, nichts spricht für die Annahme von ntl. Handschriften
in Qumran, ntl. Handschriften auf Schriftrolle sind bisher nicht belegt, die
Computerversuche sprechen gegen eine ntl. Identifizierung, der unerklärliche
Wegfall gleich dreier Wörter müßte angenommen werden, um eine stimmige Stichometrie
zu sichern, ein angeblicher Lautwechsel von Delta zu Tau kann
nicht erklärt werden (da für Palästina nicht belegbar). Das alles müßte eigentlich
reichen, um die These von der ntl. Identifizierung dahin zu verweisen, wohin
sie gehört: ins Reich der wissenschaftlichen Fabel, oder aber in den Bereich
des Wunschdenkens christlicher Konservativer, für die ein Evangelium nur dann
wertvoll ist, wenn es vor 50 n. Chr. verfaßt worden ist.
Gegen diese Einwände haben Verfechter der ntl. Identifizierung
Hilfshypothesen konstruiert, sämtliche auf tönernden Füßen. Entscheidend ist
jedoch eine ganz einfache Frage: Ist in Zeile 2, beim Buchstaben, der auf das
eindeutige Omega folgt ein Ny zu lesen oder aber ein Iota
(Vgl. Abb. 1). C. P. Thiede selbst hat die Entscheidung
über diesen Buchstaben zur ´Überlebensfrage´ seiner und J. O´Callaghans ntl.
Identifizierung erklärt: “And it is indeed crucial in one vital sense: if this
nu can be ruled out [...], the Markan identification is doomed, since
it necessitates a nu at precisely this place.” (7)
In der Erstveröffentlichung des Fragmentes (8) gibt es zu
diesem Buchstaben keinerlei Unklarheiten. Er wird von P. Boismard als Iota
gelesen, ohne Punkt, also eindeutig identifiziert. Ein solches Iota legt
die Vermutung nahe, daß es sich bei der Buchstabenkombination Tau Omega Iota
um den Dativ des bestimmten Artikels handelt. Das Iota wird von Boismard
deshalb als iota-adscriptum verstanden. Es erscheint in der Transkription
jedoch in der heute üblichen Schreibung als iota-subscriptum.
Dieses iota-subscriptum hat zu großer Verwirrung geführt, denn es wurde
mehrfach schlicht übersehen oder mit einem Punkt nach dem Leidener Klammersystem
verwechselt.
Was spricht nun für ein Iota, was für ein Ny? Die Situation ist
günstig, da beide Alternativen im Fragment 7Q5 einmal vollständig und unumstritten
vorhanden sind (Vgl. Abb. 2). Im Vergleich des Längsstriches
in Zeile 2 mit dem Iota in Zeile 3 fallen
durchaus Unterschiede auf: (9)
a) unterschiedlich geformter Buchstabenkopf / Tendenz zur
Verschmelzung mit dem Alpha am
oberen Rand
b) unterschiedlich geformter Buchstabenfuß / Tendenz zur Verschmelzung mit dem
Alpha am unteren Rand
c) der Abstrich des Iota endet vor dem unteren Zeilenende
Zu a) Auf keiner der bisher publizierten Abbildungen ist zu erkennen,
ob sich das Iota und das Alpha in Zeile 3 oben einmal berührt
haben. Im derzeitigen Zustand des Fragments gibt es allerdings keine Verbindung.
Wahrscheinlich liegt zwischen beiden Buchstaben eine leichte Beschädigung des
Papyrus vor, die eine Klärung dieser Frage zusätzlich erschwert. Unter diesen
Umständen muß hier auf ein genaueres Resultat verzichtet werden. Der Unterschied
zwischen dem Iota in Zeile 3 und
dem Längsstrich in Zeile 2 läßt sich jedoch problemlos damit erklären, daß beide
auf sehr unterschiedliche Buchstaben folgen. Neben einem Alpha ist schlicht
mehr Platz, um einen nach links ausladenden Haken zu schreiben, als neben dem
Omega in Zeile 2.
Verglichen mit den linken Längsstrichen der übrigen Buchstaben
(Iota, Ny, Eta) erscheint für den umstrittenen Längsstrich
in Zeile 2 allein ein Iota denkbar (Vgl. Abb. 3). Beim vollständigen
Ny in Zeile 4 ist der Haken am oberen Teil des linken Abstriches wesentlich
stärker ausgebildet, es besteht kaum Ähnlichkeit mit dem oberen Teil des Längsstriches
in Zeile 2. (10) Der erste Einwand gegen
die Deutung des Längsstriches als Iota ist somit hinfällig.
Zu b) Auch dieser Einwand läßt sich entkräften. Wie schon
beim ersten Einwand, wird auch hier übersehen, daß die Form des vorangehenden
Buchstaben Einfluß auf die Ausführung des nachfolgenden Buchstaben haben kann.
Die Verbindung von Omega und Iota am Buchstabenfuß ist wesentlich
schwieriger als die gleiche Verbindung zwischen Alpha und Iota.
Somit bleibt als Argument nur die etwas unterschiedliche Form der Buchstabenfüße
bestehen. Dazu ist jedoch zu bemerken, daß der Fuß des Längsstriches in Zeile
2 offensichtlich gar nicht mehr in voller Länge erhalten ist. (11)
Wenn das untere Häkchen des Längsstriches ursprünglich nur ein wenig weiter
nach links gereicht hat, dann ist seine Form identisch mit dem Fuß des sicheren
Iota aus Zeile 3.
Wenn die untere Häkchenbildung des Längsstriches von Zeile 2 und des sicheren
Iota aus Zeile 3 einerseits nun mit dem Häkchen des sicheren Ny
(Zeile 4) oder auch der beiden Eta (Zeile 4, 5) andererseits verglichen
wird, dann fällt auf, daß die Häkchenform des Längsstriches nur mit dem unteren
Ende des Iota zu vergleichen ist (Vgl. Abb. 3). In beiden Fällen
sind die Häkchen leicht nach links unten geneigt, während die Häkchen sowohl
des Ny als auch der beiden Eta waagerecht gezogen sind. Auch der
zweite Einwand gegen eine Entzifferung des Längsstriches in Zeile 2 als Iota konnte also nicht
bestehen.
Zu c) F. Rohrhirsch hat ganz recht, wenn er feststellt,
der Abstrich des Iota reiche nicht bis zum Zeilenende, er ende ein wenig
oberhalb. (12) Aber exakt dieser Fall liegt
auch beim Längsstrich in Zeile 2 vor, wie ein Blick auf die publizierten Abbildungen
nahelegt und durch die extrem vergrößerte Abbildung bei C. P. Thiede (13) nun auch erwiesen ist. Der
senkrechte Abstrich endet knapp oberhalb der – freilich immer unregelmäßigen
– Grundlinie. Darunter setzt dann das von links unten nach rechts oben verlaufende
Häkchen an. Dabei gibt es keinerlei Unterschied zwischen dem Längsstrich in
Zeile 2 und dem Iota in Zeile 3. (14) Auch dieser Einwand ist
also keiner, statt dessen verweist er auf eine besonders auffällige Ähnlichkeit
des Längsstriches aus Zeile 2 mit dem Iota in Zeile 3.
Die von den Befürwortern der mk. Identifizierung vorgetragenen
Argumente gegen die Lesung des Längsstriches in Zeile 2 als 4
haben sich allesamt als nicht stichhaltig erwiesen. Die genauere Untersuchung
brachte statt dessen deutliche Hinweise gegen das von O´Callaghan, C. P. Thiede,
F. Rohrhirsch, H. Hunger u. a. gelesene Ny.
Schon an dieser Stelle ist dem Iota der unbedingte
Vorzug zu geben! (15)
H. Hunger versuchte 1991 die ntl. Identifizierungsthese papyrologisch zu stützen. (16) Auf 24 Seiten mit 23 Abbildungen verfolgt er folgenden Argumentationsgang: Gleiche Schreiber führen gleiche Buchstaben im gleichen Dokument häufig sehr unterschiedlich aus. Das ist sicher richtig, trifft aber für das Fragment 7Q5 nicht wirklich zu. Sämtliche im Fragment doppelt vorhandenen Buchstaben zeigen im Gegenteil beim Übereinanderkopieren eine überraschend hohe Deckungsgleichheit (das gilt auch für die auf den ersten Blick unterschiedlichen Eta!). Auch der Verweis H. Hungers auf die beiden verschiedenen Typen des Buchstaben Ny – ´falling type´ und ´rising type´ – kann nicht überzeugen. Das von ihm als “Urform” vorgeführte ´rising type´ (17) Ny hat keine Ähnlichkeit mit einem aus den vorhandenen Tintenspuren des Fragmentes 7Q5 rekonstruierten Ny. Das Ny in Zeile 4 ist außerdem zweifelsfrei ein ´falling type´ Ny. Die von H. Hunger angeführten Abbildungen zeigen zwar immer wieder unterschiedlich geformte Buchstaben des gleichen Schreibers im gleichen Text, die abgebildeten Ny sind aber in einem einzelnen Papyrus entweder alle ´rising type´ oder ´falling type´, niemals werden diese beiden Grundformen des Buchstaben Ny in einem Text vermischt gebraucht. Genau das muß aber für 7Q5 angenommen werden, damit H. Hungers Hinweis argumentativen Wert erhielte. Dann versucht er, eine neue Form für das angebliche Ny in Zeile 2 plausibel zu machen, was aber eine Unterschiedlichkeit in der Buchstabenausführung voraussetzt, die sich weder im Fragment 7Q5, noch in einem Vergleichspapyrus finden läßt.
C. P. Thiede verteidigt nach wie vor die Lesung eines Ny
in Zeile 2. Er gibt an, die Breite der beiden Eta (Z. 4, 5) mit der des
sicheren und des in Zeile 2 rekonstruierten Ny gemessen und verglichen
zu haben. Der Schwankungsbereich sei bei beiden gleich gewesen. In Zeile 2 gibt
es jedoch keinerlei Anhaltspunkte für die ´äußerste Breite´ des angeblichen
Ny, denn diese würde ja durch das obere Häkchen am rechten Abstrich gebildet.
Von diesem Häkchen fehlt jede Spur, es ist nichts davon zu sehen. Es kann kaum
als Kennzeichen seriöser Forschung gelten, etwas zu vermessen, das nicht da
ist und als Ergebnis einen Wert im Genauigkeitsbereich eines zehntel Millimeters
zu präsentieren. Tatsächlich ist die Breitenabweichung zwischen den beiden Eta
nicht meßbar (Vgl. Abb. 4), zwischen dem Ny in Zeile
4 und dem angeblichen Ny in Zeile 2 ist sie jedoch beträchtlich (Vgl.
Abb. 5). Auch das läßt sich am besten zeigen, wenn Abbildung und Folienkopie
übereinandergelegt betrachtet werden. Während die beiden Eta fast vollständig
deckungsgleich sind (Vgl. Abb. 6), gibt es zwischen dem
sicheren Ny von Zeile 4 und den Tintenresten rechts des Längsstriches
von Zeile 2 keinen Berührungspunkt, vielmehr nur einen ´Schnittpunkt´ (Vgl.
Abb. 7). (18) Es ist somit erwiesenermaßen falsch zu
behaupten, die beiden Ny seien im gleichen Maße verschieden, wie die
beiden Eta. Richtig ist dagegen: Die beiden Eta sind nahezu identisch,
das erhaltene und das behauptete Ny sind dagegen vollkommen verschieden.
Zur Stützung seiner These veranlaßte C. P. Thiede eine mikroskopische Untersuchung
des Fragmentes 7Q5. Dankenswerterweise gibt C. P. Thiede seinem Bericht einen
Computerausdruck der betreffenden Stelle in extremer Vergrößerung bei – die
genaue Vergrößerung ist leider nicht angegeben, dürfte aber ca. 30 – 40-fach
sein. Hier ist neben dem senkrechten Strich etwas Dunkles zu erkennen. Nun wird
beim benutzten Stereo-Mikroskop das Licht flach von der Seite eingestrahlt,
was zu deutlichem Schattenwurf führt. Rechts neben dem
senkrechten Strich in Zeile 2 ist eine sehr unregelmäßige, rauhe Stelle im Papyrus
deutlich zu erkennen. Die Erhebungen an dieser Stelle verursachen einen Schattenwurf,
der durchaus Ähnlichkeiten mit Tintenresten suggerieren kann, vor allem,
wenn jemand an dieser Stelle Tintenreste zu sehen wünscht. (19)
Die Vergrößerung dient dennoch der Klärung dieser umstrittenen Frage, denn sie
ermöglicht nun die definitive Entscheidung gegen das Ny in Zeile 2. Rechts
vom senkrechten Strich ist deutlich ein Neuansatz des Schreibers zu erkennen.
Ein Neuansatz an dieser Stelle ist jedoch auf gar keinen Fall mit einem Ny
zu vereinbaren. In Zeile 2 kann hinter dem Omega nun ein Iota
als sicherer Buchstabe angeführt werden. Ein Ny ist dagegen definitiv
ausgeschlossen.
C. P. Thiede hält trotz der eigentlich eindeutigen Argumente gegen das Ny
weiterhin an seiner falschen Lesung fest, um die These der mk. Identifizierung
zu retten. Wie weit er dabei geht, läßt sich an der englischen Ausgabe des Buches
“The Jesus Papyrus” zeigen. Im Innendeckel des Buches ist eine Buchstabenrekonstruktion
abgebildet: ein rekonstruiertes Ny ist hinter das Omega gesetzt
worden. Dieses rekonstruierte Ny ist aber nicht deckungsgleich mit den
Tintenspuren des Original-Fragmentes! Die Tintenspuren müßten unterhalb des
Diagonal-Balkens des rekonstruierten Ny sichtbar sein. Dort ist aber
nur unbeschriebener Papyrus zu sehen. Um die Rekonstruktion glaubwürdiger erscheinen
zu lassen, werden aus der Abbildung des Originals unzweideutige Tintenspuren
entfernt. Hier werden ganz bewußt Tatsachen gefälscht, denn nur diese Täuschung
läßt das rekonstruierte Ny plausibel erscheinen. In der deutschen Ausgabe
verzichtet C. P. Thiede auf diesen ´Kunstgriff´, mit dem Effekt, daß die Rekonstruktion
des Ny längst nicht in gleichem Maße überzeugend wirkt.
Fazit:
Die genaue Untersuchung der Zeile 2 führte zu einem klaren Ergebnis. Hinter
dem Omega ist ein Iota zu lesen. Das von J. O´Callaghan, C. P.
Thiede und anderen Vertretern der mk. Identifizierung geforderte Ny ist
dagegen definitiv ausgeschlossen. Letzte Sicherheit in dieser Frage erbrachte
die von C. P. Thiede selbst angestrengte mikroskopische Untersuchung des Fragmentes
7Q5. Die mk. Identifizierung benötigt an dieser Stelle unbedingt ein Ny.
Da dieses nicht vorhanden ist, kann die Identifizierung des Fragmentes 7Q5 mit
Mk 6, 52 – 53 spätestens an dieser Stelle definitiv abgelehnt werden.
Die These 7Q5 = Mk 6, 52 – 53 ist falsifiziert.
Paderborn Stefan Enste
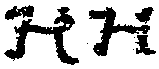 Abb. 4: H in Zeile 5 und Zeile 4 |
|
|
Abb. 6: |
Abb. 7: |
![]()
Anmerkungen:
![]()
![]()